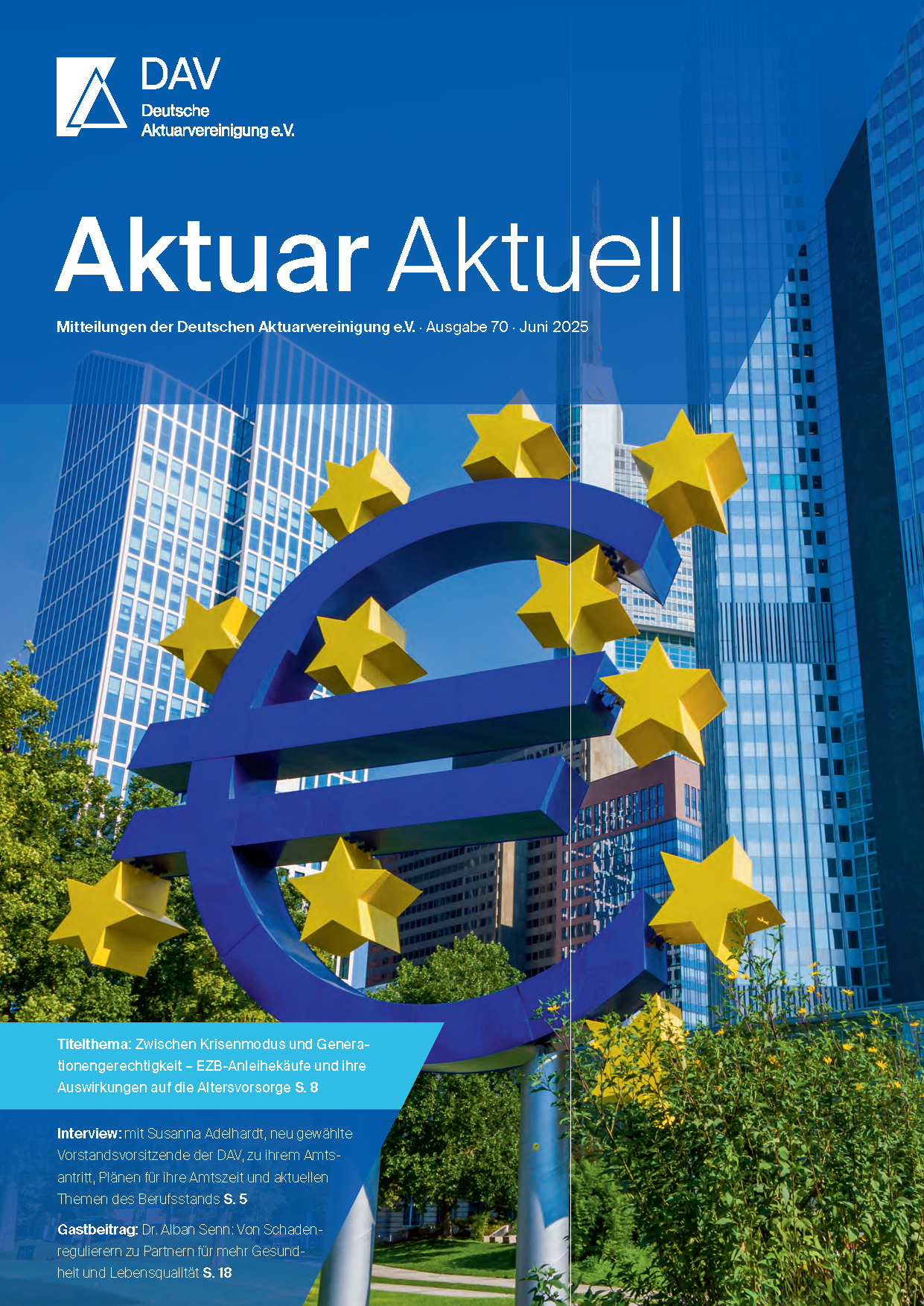Zwischen Krisenmodus und Generationengerechtigkeit – EZB-Anleihekäufe und ihre Auswirkungen auf die Altersvorsorge
Zwischen Krisenmodus und Generationengerechtigkeit – EZB-Anleihekäufe und ihre Auswirkungen auf die Altersvorsorge
In den vergangenen Jahren hat die Europäische Zentralbank (EZB) tiefgreifend in die Kapitalmärkte eingegriffen. Dies geschah mit der Intention, Inflationsziele zu erreichen und akute Marktspannungen abzufedern. Anleihenankaufprogramme wie das Public Sector Purchase Programme (PSPP) oder das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) waren zentrale Instrumente dieser expansiven Geldpolitik. Doch der Rückblick zeigt: Diese Maßnahmen haben langfristig auch Schatten geworfen – insbesondere auf die Altersvorsorge. Die künstlich gesenkten Zinsen haben die Ertragschancen vieler Vorsorgeformen geschmälert und stellen das Prinzip der Generationengerechtigkeit zunehmend infrage. Mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) und der geplanten Einführung eines strukturellen Wertpapierportfolios stehen zudem neue Werkzeuge bereit, deren Einsatz nicht nur für die Kapitalmärkte, sondern auch für das Vertrauen in die langfristige Verlässlichkeit der Vorsorgesysteme weitreichende Folgen haben könnte.
Die neue Normalität der Krisenintervention
Seit der Eurokrise agiert die EZB zunehmend mit unkonventionellen Mitteln. Spätestens während der Coronapandemie wurden Ankaufprogramme wie das PEPP zu einem zentralen geldpolitischen Steuerungsinstrument. Die Staatsanleihemärkte wurden stabilisiert, Renditen deutlich gesenkt – zeitweise um mehr als 150 bp – und Liquidität bereitgestellt. In der Folge sank das allgemeine Zinsniveau in der Eurozone auf historische Tiefststände – mit erheblichen Auswirkungen auf langfristige Finanzierungen, Rentenversprechen und Vorsorgeprodukte. Auch wenn sich die EZB inzwischen basierend auf Aussagen aus dem EZB-Direktorium scheinbar von der Vorstellung verabschiedet hat, großvolumige Anleihekäufe dauerhaft als Mittel zur Inflationssteuerung zu nutzen, bleiben die Folgen dieser Politik und das Risiko ihrer Wiederholung weiterhin bestehen.
Marktverzerrung und verfassungsrechtliche Leitplanken
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. Mai 2020 zum PSPP-Programm klare Bedingungen formuliert, damit Anleihekäufe nicht zur verbotenen monetären Staatsfinanzierung führen. Als zentrale Schranken gelten eine Kaufobergrenze von 33 Prozent pro Emittent und Emission sowie die Verteilung der Käufe nach dem EZB-Kapitalschlüssel. Diese Prinzipien wurden in der Praxis jedoch teilweise gerissen – insbesondere infolge des PEPP, da in Summe mit dem PSPP die 33-Prozent-Grenze für einzelne Länder deutlich überschritten wurde. Das neu geschaffene TPI erlaubt nun sogar unbegrenzte und selektive Käufe einzelner Staatsanleihen, um „ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken“ entgegenzuwirken. Damit droht eine institutionelle Grauzone, in der rechtlich gebotene Begrenzungen und wirtschaftliche Zielsetzungen in Konflikt geraten.
Zielkonflikte und paradoxe Wirkungen
Wenn der Preis von Staatsanleihen nicht mehr nur durch Angebot und Nachfrage, sondern auch durch mögliche Interventionswahrscheinlichkeit der Zentralbank bestimmt wird, verlieren Investoren das Vertrauen in die Signalwirkung des Marktpreises. Besonders betroffen sind langfristige Anleger wie Lebensversicherer und Pensionskassen, deren Zusagen auf planbaren, risikoarmen Erträgen basieren. In der Folge steigen die Anforderungen an Eigenmittel, die Verzinsung sinkt, die Altersvorsorge wird teurer – für Unternehmen wie für private Haushalte.
Auswirkungen auf die Generationengerechtigkeit und soziale Systeme
Die langfristigen Konsequenzen treffen vor allem jene Bevölkerungsgruppen, die für sich selbst vorsorgen müssen oder wollen – sei es durch eigene Sparanstrengungen oder betriebliche Versorgung. Wer heute vorsorgt, muss mehr Kapital aufbringen, um dieselbe Leistung zu erzielen. Das ist für viele nicht leistbar. Gleichzeitig steigen die staatlichen Ausgaben für Rente, Gesundheit und Pflege. Jüngere Generationen müssen daher zwei Herausforderungen gleichzeitig finanziell bewältigen: Sie müssen nicht nur für ihre eigene Zukunft vorsorgen und dafür mehr aufwenden, sondern auch die Lasten wachsender Staatsschulden und einer alternden Bevölkerung tragen. Die politische Forderung nach umfassenderen sozialen Sicherungssystemen, steigenden Verteidigungs- und Infrastrukturinvestitionen sowie mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen steht damit in einem Spannungsverhältnis zur realen Finanzierbarkeit. Das gilt besonders dann, wenn die EZB über niedrige Zinsen und hohe Liquidität Marktverhältnisse beeinflusst.
Notwendigkeit von Transparenz und neuen Leitlinien
Mit der angekündigten Schaffung eines strukturellen Wertpapierportfolios könnte die EZB endgültig in eine neue geldpolitische Phase eintreten: Weg von temporären Sondermaßnahmen, hin zu einer dauerhaften Präsenz als Marktakteur. Umso wichtiger ist es, die verfassungsrechtlich gebotenen Prinzipien nicht nur zu wahren, sondern ihre Einhaltung für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu gestalten. Dazu gehört auch eine klare Exit-Strategie für bestehende Anleihebestände. Bislang erfolgen Rückführungen nur passiv über Tilgungen zur Endfälligkeit, obwohl das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich betont hat, dass aktive Verkäufe der Regelfall sein sollten, sobald die geldpolitische Notwendigkeit entfällt.
Fazit
Eine generationengerechte Geldpolitik braucht klare Grenzen. Die expansive Geldpolitik der vergangenen Jahre hat Europa vor akuten Krisen bewahrt, aber sie hat auch bestehende strukturelle Probleme verschärft, indem eine Lösung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und dabei die Last größer wird. Besonders in der kapitalgedeckten Altersvorsorge sind die Nebenwirkungen spürbar: Renditen sinken, Kapitalbedarf steigt, und das Vertrauen in die langfristige Planungssicherheit leidet. Es braucht ein neues Gleichgewicht zwischen kurzfristiger Stabilisierung und langfristiger Verantwortung. Die EZB muss ihre Instrumente transparenter und im Einklang mit rechtlichen Vorgaben bewerten. Vor allem aber sollten politische und geldpolitische Akteure gemeinsam darauf achten, dass der bloße Verdacht einer finanziellen Repression vermieden wird, denn diese ginge primär auf Kosten derer, die selbstbestimmt vorsorgen müssen oder wollen. Generationengerechtigkeit ist ein wichtiger sozialer Grundpfeiler und darf nicht infolge moderner Geldpolitik nachhaltig Schaden nehmen.