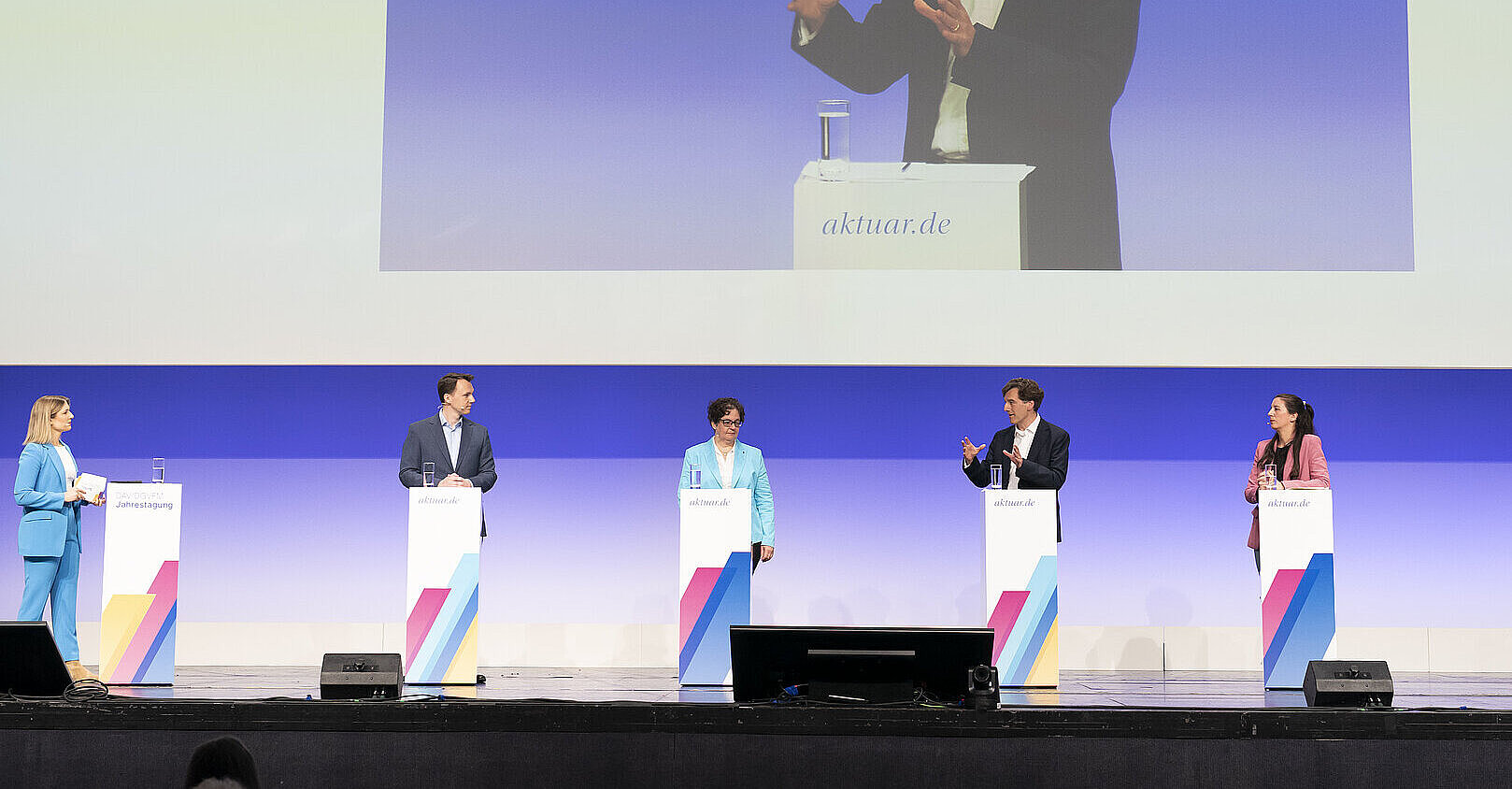Fonds, Risikogemeinschaften und die Gretchenfrage nach der Pflicht

Dass Panel unter dem Titel „Von Fonds und Risikogemeinschaften: Perspektiven für ein zukunftsfähiges Rentensystem“, souverän geleitet von der ARD-Finanzmarktjournalistin Melanie Böff (u. a. Börse vor Acht), bestand aus Pascal Reddig, CDU-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Junge-Unions-Vorsitzender, Lena Teschlade, Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen und Sprecherin für Sozialpolitik der dortigen SPD-Fraktion, Graham Pearce, Aktuar, Partner bei Mercer und Spezialist für den Mercer Pension Index, sowie Susanna Adelhardt, just am Vortag zur neuen Vorsitzenden der DAV gewählt. Mit einer Keynote zur Umstellung des niederländischen Altersversorgungssystems auf die reine Beitragszusage steuerte Falco Valkenburg, seines Zeichens vormaliger Präsident der Actuarial Association of Europe (AAE), einen englischsprachigen Impulsvortrag bei.
Die Diskussion wandte sich zunächst den erheblichen finanziellen Bedürfnissen von Menschen im Alter, die unter anderem von Pflegenotwendigkeit geprägt wird, sowie allen drei Säulen der Altersversorgung und Altersvorsorge zu, also der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung und den kapitalmarktorientierten Säulen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und privaten Altersvorsorge. Während Susanna Adelhardts Kritik am Zustand des Rentensystems, am Aushöhlen der Beitragsäquivalenz der gesetzlichen Rentenversicherung und ihre Ausführungen zur Notwendigkeit eines deutlichen Commitments zu lebenslangen Zahlungsströmen, die Altersarmut verhindern und Lebensstandard bis zum Tode sichern, die bekannter-maßen deutliche Position der Aktuarinnen und Aktuare wiedergab, fielen insbesondere Pascal Reddig und Lena Teschlade mit einer im politischen Kontext nicht ganz alltäglichen, sehr offenen Haltung zu Reformen auf.
Reddig, der als frisch gewählter Vorsitzender der Jungen Gruppe im Bundestag und JU-Repräsentant ein besonderes Augenmerk auf generationengerechte Ausgestaltung der gesetzlichen Rente hat, forderte zu mehr Mut und offener Kommunikation auf politischer Ebene auf. Die kommende Legislaturperiode sei entscheidend. Auch Zumutungen müssten den Menschen benannt werden. Ein Aspekt sei, dass die gesetzliche Rente nicht das wird leisten können, was zum Teil noch immer versprochen werde. Daher seien die Säulen zwei und drei so wichtig. Reddig stellte aber infrage, ob das Problem über reine Freiwilligkeit zu lösen sei. Er schlug stattdessen ein verpflichtendes, ergänzendes System vor, das aber flexibel auf individuelle Situationen reagiere. Etwa im Falle einer abzuzahlenden Haus-Hypothek oder bei entsprechender anderweitiger Vorsorge.
Lena Teschlade betonte die wichtigen Schritte, die mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz bereits 2018 unternommen worden seien, etwa die 15-Prozent-Zuschusspflicht von Arbeitgebern bei der bAV. Wesentlich sei, dass bAV auch im Mittelstand tief verankert werde. Anders als Reddig, der die Notwendigkeit für eine längere Lebensarbeitszeit grundsätzlich durchaus sieht, positionierte sich Teschlade ganz auf SPD-Linie gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Dennoch gab sie zu, dass der demografische Wandel eine enorme Herausforderung darstellt. Das von der Ampelregierung vorgesehene Generationenkapital führte sie als positives Beispiel für Reformvorhaben aus.
Laut Graham Pearce sei Deutschland insgesamt nicht optimal aufgestellt, insbesondere, was die Flexibilität der staatlichen Modelle von Zusatzvorsorge angeht, als auch, was deren Verbreitung betrifft. Länder Skandinaviens oder die Niederlande hätten deutlich stärker ausgeprägte kapitalgedeckte Anteile an der Alterssicherung. Eine Gemeinsamkeit: Diese kommen im Wesentlichen durch Pflichtlösungen zustande. Die Komplexität, die Pearce am Beispiel seines eigenen Riestervertrages ausführte, stehe den Deutschen im Wege. Die starken Bilanzierungshürden für Garantieleistungen aus der bAV seien wiederum ein Hemmschuh für Arbeitgeber.
Die folgende fachliche Keynote Falco Valkenburgs, der die Reformfähigkeit von Sozialpartnern und Bevölkerung in den Niederlanden betonte und die Umstellung auf eine garantiefreie Zusage von Beiträgen beschrieb, zahlte insbesondere auf diesen Punkt ein. Anschließend ging es in der Diskussion im Schwerpunkt um aktuelle Entscheidungen der neuen Regierung, die durch die Zustimmung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag genau an diesem Morgen des 30. April, dem letzten Tag der 2025’er Jahrestagung von DAV und DGVFM, ihre letzte Hürde genommen hatte.
Pascal Reddig betonte, dass nun Schritte unternommen werden, auch wenn man sich aus Unionssicht deutlich mehr erwartet habe. Positiv hob er die Frühstartrente hervor, die kommenden Generationen einen Anlass und eine Sensibilität für die Notwendigkeit von Investitionen schaffen kann. Dieser Punkt wurde auch von Graham Pearce unterstützt. Reddig erklärte aber auch, dass es noch Justierung geben müsse, um das System dauerhaft tragfähig zu halten. Dazu zählte er – anders als Frau Teschlade – eine Kopplung der Lebensarbeitszeit an die steigende Lebenserwartung. Auch Beiträge und Rentenniveau müssten sozialverträglich ausgestaltet werden. Er setze auf die Entwürfe der nächsten Rentenkommission und dass diese auch Berücksichtigung finden.
Dass der Koalitionsvertrag nicht „der große Wurf“ sei, sagte auch Lena Teschlade. Sie führte, etwas über das eigentliche Thema hinausweisend, auch noch aus, dass insbesondere mit Blick auf Beamtenpensionen deutlich gesagt werden müsse, dass der Status quo so nicht haltbar sein werde.
Susanna Adelhardt hob hervor, dass Flexibilisierung, finanzielle Bildung und Eigenverantwortlichkeit die entscheidenden Begriffe seien, um die Alterssicherung in Deutschland voranzubringen. Die Losung in Sachen Alterssicherung, so Adelhardt im Schlussplädoyer, müssen jetzt sein: „Loslegen, machen, jetzt!“